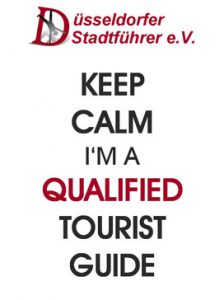Überall in der Stadt läuft man über kleine Messingplatten im Bürgersteig – die sogenannten „Stolpersteine„. Sie erinnern an die Opfer des Unrechtsregimes der Nationalsozialisten. Einer der jüngsten Stolpersteine in Düsseldorf wurde im Juni 2025 ins Pflaster des Bürgersteigs vor dem Haus Karl-Anton-Straße 11 – dem Hotel Prinz Anton – eingelassen. Er erinnert an Kurt Matthias Frank.
Kurt Matthias Frank war seinerzeit einer der bekanntesten Rechtsanwälte Düsseldorfs, zeitweise hatte er zwölf Angestellte in seiner Kanzlei. Deren Räume waren in der Breite Straße und auf der Königsallee. Zu seinen Mandanten zählten auch heute noch bekannte Namen wie die Allianz, die Nordstern Versicherung, die Bergischen Kraftfutterwerke, die Firma Klein am Wehrhahn sowie die einflussreichen Unternehmer Albert Schöndorff und Moritz Grünthal. Letzterer hatte unter anderem das Düsseldorfer Schauspielhaus gefördert und stand in Briefkontakt mit dem unbeugsamen Netzwerker Herbert Eulenberg.
Weil Frank im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte und ausgezeichnet wurde, war er nicht bei dem ersten Schwung der Juden-Verfolgung, Verhaftung und Deportation dabei. Seine Ehe mit einer Nicht-Jüdin führte dazu, dass er zunächst als „Konsulent“ – ein spezieller Rechtsanwalt für jüdische Mandanten – weiter arbeiten durfte. Er war einer der wenigen Juden, die nach 1938 im Kammerbezirk Düsseldorf überhaupt als Rechtsanwalt tätig sein durften und der letzte jüdische Anwalt Düsseldorfs im Zweiten Weltkrieg.

Dass Frank noch weiter als Anwalt arbeiten konnte, dazu trug auch bei, dass sein Vater das Haus Karl-Anton-Straße 11 gekauft hatte. Weil das Eigentum in der Familie war, hatte Karl Matthias Frank keinen Stress mit Vermietern, die bei jüdischen Mietern jede Ausrede suchten, um die Mietverträge zu kündigen. So erging es ihm nämlich mit seinen Büroräumen: In der Reichspogromnacht vom 10. November 1938 hatten SS- und SA-Männer seine Kanzlei gestürmt, Mobiliar zertrümmert und alle Akten durch die Fenster auf die Straße geworfen. Weil dabei auch Fenster und Türen zu Bruch gegangen waren, kündigte ihm der Vermieter.
Am 12. Juni 1943 wurde das Haus in der Karl-Anton-Straße 11 bei einem Bombenangriff getroffen. Frank zog mit seiner arischen Ehefrau in das Haus der jüdischen Gemeinde in Bilk und wurde im Juni 1943 deren Vorsitzender. Im Oktober desselben Jahres war es dann soweit und die Gestapo hatte eine Ausrede gefunden, auch gegen Kurt Matthias Frank vorzugehen: Ihm wurde Vermögensverschiebung vorgeworfen. Ob an den Vorwürfen etwas dran war, lässt sich nicht sagen – vermutlich waren sie vorgeschoben, denn als Anwalt musste er sich ja auch um das Vermögen seiner Mandanten kümmern. Er kam ins Gestapo-Gefängnis Ulmer Höh in der Ulmenstraße in Derendorf.
In einem Brief an seine Frau berichtete er über die drohende Deportation und eine Aussage des Gestapobeamten Wasserbillig: „Zum Vergasen in Auschwitz braucht man nicht haftfähig zu sein.“ Da sag mir einer, die Menschen hätten damals nichts davon gewusst, dass Juden systematisch vergast wurden.
Frank war klar, dass sein Tod nur noch eine Frage der Zeit sei. Am 8. Mai 1944 – genau ein Jahr vor Kriegsende – wurde Frank dann tatsächlich nach Auschwitz deportiert. Doch er wurde nicht direkt in die Gaskammer geschickt. Statt dessen erlebte er sogar die Befreiung.
Das KZ Auschwitz wurde am 27. Januar 1945 von sowjetischen Truppen der Roten Armee befreit. Die Befreiung erlebte Kurt Matthias Frank noch. Er war allerdings so schwer krank und entkräftet, dass er knapp einen Monat später – am 24. Februar – verstarb. Das ist die Geschichte hinter dem Todesdatum. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass mit dem Ende der Schreckensherrschaft vor Ort die Schrecken eben noch lange nicht zu Ende waren. Und es gibt sicherlich Menschen, die meinen, er sei eines natürlichen Todes gestorben und gar nicht ermordet worden. Das sehe ich aber wie der Stolperstein: Menschen verhungern zu lassen und ihnen keine medizinische Behandlung zu gewähren ist Mord.
Gedenkbuch zur Erinnerung an die jüdischen Opfer
Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat vor einigen Jahren ein digitales Gedenkbuch eingerichtet, das zur Erinnerung an die jüdischen Opfer 1933 – 1945 dient. Es dokumentiert die Lebensdaten und Lebenswege von 2.633 Düsseldorferinnen und Düsseldorfern, die Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung wurden. Die Nationalsozialisten haben versucht, diese Menschen und ihre Lebenswege aus der Geschichte zu tilgen. Dazu gehörte, dass die Meldebehörden angewiesen wurden, nach der Deportation nicht das konkrete Ziel des Transportes einzutragen, sondern nur „unbekannt verzogen“ oder „ausgewandert“. Das Gedenkbuch hat den Anspruch, diese Menschen als individuelle Persönlichkeiten wieder sichtbar zu machen. Auch das Leben von Kurt Matthias Frank ist darin ausführlich beschrieben.