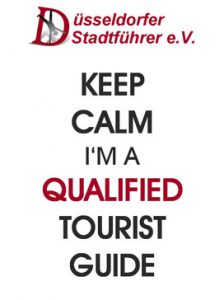Im August 2005 wurde die Glasproduktion in Gerresheim nach 141 Jahren eingestellt. Das ist in diesem Monat nun schon 19 Jahre her… Heute drehen sich die Diskussionen in der Stadt vorrangig um die bislang noch nicht erfolgte Bebauung im Glasmacherviertel. Was dabei oft untergeht ist die Bedeutung, die Gerresheimer Glas auf der ganzen Welt hatte. Denn wer denkt, dass Globalisierung eine Errungenschaft der heutigen Zeit ist, der irrt. Schon vor mehr als 100 Jahren
Aus diesem Anlass habe ich einen Buchtipp: „Tage aus Glas“ von Dorothee Krings, erschienen im Verlag HarperCollins: https://www.harpercollins.de/products/tage-aus-glas-9783365009178
Dorothee Krings, eine Journalisten-Kollegin von der Rheinischen Post, stolperte über das Thema „Streik der Glasbläser im Jahr 1901“ während eines Interviews mit einem Historiker. Und weil sie nicht die Arbeitergeschichte aus der üblichen männlichen Sicht erzählen wollte, wählte sie zwei weibliche Protagonistinnen: eine Arbeiterin und die Tochter des Werksarztes. Denn einen solchen hatte die für ihre Zeit überdurchschnittlich sozial agierende Gerresheimer Glashütte damals schon. Beide ringen mit den Grenzen ihres Seins: die Arbeiterin Bille vor allem mit den finanziellen, die Arzttochter mit den Konventionen.
Was mir nicht bewusst war: Ein Streik, so wie wir ihn heute kennen, war damals nicht möglich. Man musste kündigen, wenn man mit dem Arbeitgeber und seinen Arbeitsbedingungen unzufrieden war. Kündigte ein Großteil der Belegschaft auf einen Schlag, dann war das ein Streik. Die Gerresheimer streikten damals aus Solidarität – und um politische Ziele zu erreichen. Denn ihnen ging es im Vergleich mit anderen Glashütten relativ gut: Es gab Werkswohnungen, Männer- und Pensionistenwohnheime und eine Krankenversicherung mit kostenlosen Medikamenten … und das etliche Jahre vor der Einführung der allgemeinen Krankenversicherung. Mit einem Streik riskierten Arbeiter damals ihre ganze Existenz, denn mit der Kündigung verloren sie auch ihre Wohnung. Heute sollten wir ihnen dankbar sein, denn sie haben u.a. das Streikrecht für uns alle erkämpft.
Mit schöner und packender Sprache versetzt Krings die Leserschaft ihres Romans in die Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Manches lässt sich heute noch vor Ort finden, beispielsweise die Abbruchkante des Sandbruchs oder auch die Kneipe „Rotkehlchen“, die in Wirklichkeit „Nachtigall“ heißt. So wie die Autorin alle Namen der Protagonisten verändert hat, denn „ich kannte sie ja nicht und mochte den historischen Persönlichkeiten nicht Unrecht tun“.
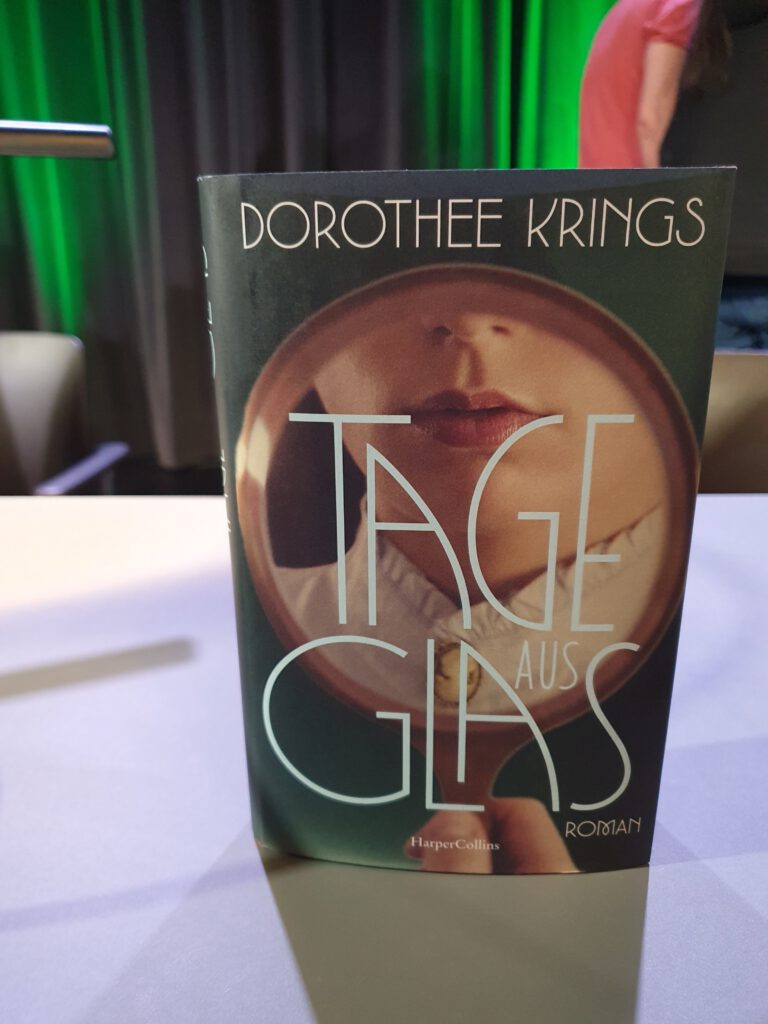
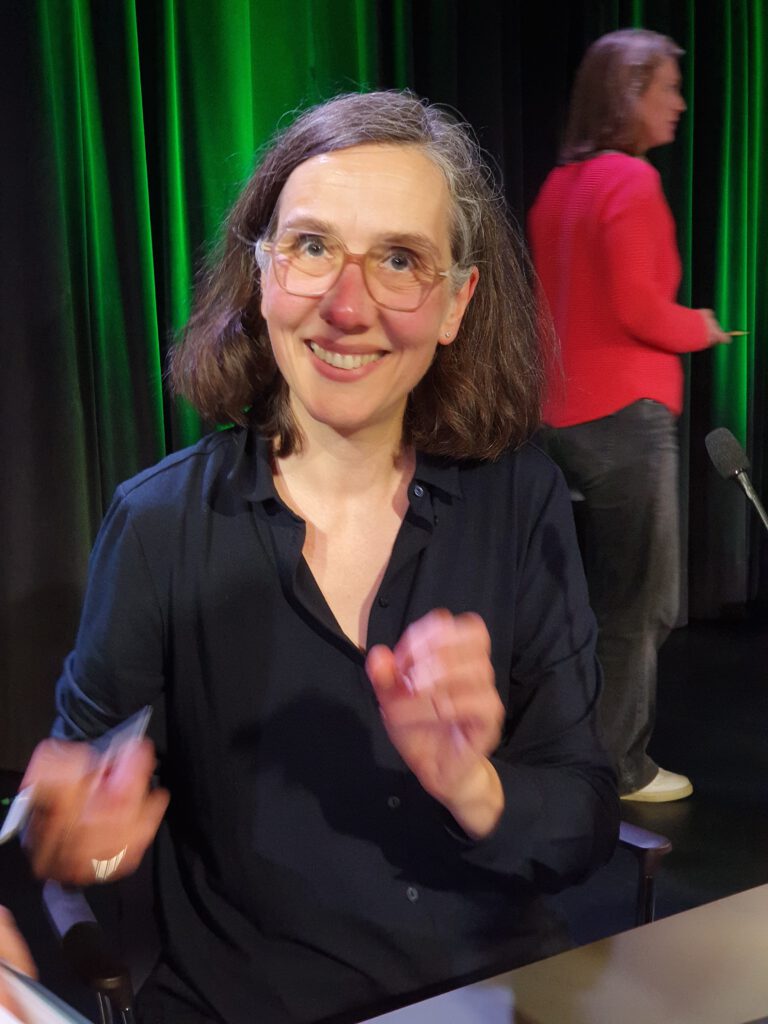
Die Fotos stammen von ihrer Lesung in der Düsseldorfer Stadtbücherei im April 2025.
Die Gerresheimer Glashütte war eine der größten Glashütten der Welt und das Stammwerk der heute noch bestehenden Gerresheimer AG. Zeitweise arbeiteten mehr als 8.000 Menschen dort. Das Logo der Gerresheimer Glashütte, ein großes „G“ mit Krone, zierte europaweit Glasflaschen und Konservengläser. Hier wurden jahrzehntelang beispielsweise die markanten Glasflaschen mit „Taille“ von Coca Cola hergestellt.
Auf der App Lialo.com habe ich eine selbstgeführte Stadtführung per Smartphone durch Gerresheim erstellt: Von Rittern und adligen Stiftsdamen in Gerresheim. Weil die Glashütte nicht in Gerresheims Altstadt war, sondern eine völlig separierte Siedlung, kommt diese allerdings nicht auf der Tour vor.
Auf der Lesung von Dorothee Krings habe ich übrigens erstmals vom „Hötter Platt“ gehört: Diese inzwischen ausgestorbene Mundart wurde „op de Hött“ – auf der Hütte = auf der Glashütte gesprochen. Die Glasbläserfamilien kamen nämlich zum großen Teil nicht aus Düsseldorf und Umgebung, sondern vor allem aus Niederdeutsch sprechenden Gebieten östlich der Elbe, beispielsweise aus Pommern, Mecklenburg und Westpreußen. Jeder brachte seine Mundart mit, die Arbeiter verstanden sich kaum untereinander So entstand eine eigene Sprache, die sich von den ursprünglichen deutlich unterschied. Weil die Hötter meist unter sich blieben, nahmen sie von den ganz anderen Dialekten der Umgebung wurde hingegen praktisch nichts auf . Mehr dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6tter_Platt
Dass Gerresheim ein „Little Italy“ ist, ergab sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch viele Einwanderer aus Italien.